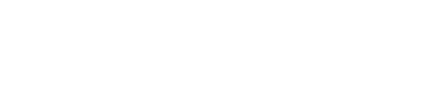„Colours of Carinthia“ war eines der erfolgreichsten Fotoprojekte, an denen ich je beteiligt war. 50 Migranten aus 50 Ländern dieser Welt erzählten ihr Schicksal in eigenen Worten und wurden in meinem damaligen Studio vor Christian Brandstätters und meine Kamera gebeten. Eine große Ausstellung, ein Medienprojekt und ein Buch entstanden. 2012 wurde das Projekt mit dem Bürgerpreis der Europäischen Union und mit dem Creos in Gold für die beste Kampagne gewürdigt.
Die Schriftstellerin Eva Menasse schrieb das beeindruckende Vorwort zum Buch „Colours of Carinthia“, das im Wieser Verlag, Klagenfurt, erschienen ist:
„Seit vielen Jahren wundert mich, dass in Österreich, diesem hochkreativen Land, noch niemand auf die Idee gekommen ist, eine Agentur für breitenwirksame Gegenpropaganda zu gründen. Ich habe mir dabei zum Beispiel kurze Filmchen vorgestellt, in denen unsere beliebtesten Kabarettisten, Schauspieler und Moderatoren mitwirken, und die im Fernsehen und in den Kinos laufen könnten. Da hätte man etwa, am Höhepunkt der Tschetschenen-Hetze des BZÖ, eine glückliche Kärntner Familie sehen können, am besten in Tracht, in einem wunderschönen Haus mit Blumen vor den Fenstern. In der guten Stube ein gepflegter Herrgottswinkel, auf dem Tisch dampfende Kasnudeln. Aber dann werden sie bei Nacht und Nebel von vermummten Soldaten zusammengetrieben, auf Lastwagen verladen und weggebracht. Schreie, ein einäugiger Teddybär im Schlamm. Schnitt. Plötzlich sitzen sie auf einem anderen Kontinent im Flüchtlingslager, Dirndl und Lederhosen wirken grotesk, niemand will sie haben, der unrasierte und schmutzige Familienvater sieht schon etwas bedrohlich aus, in den Jobanzeigen der fremden Zeitungen steht „Coloured people only“. Die Kärntner Familie hat plötzlich alles verloren und keine Chance. Es ginge nur um diese Änderung des Blickwinkels. Denn mir ist rätselhaft, warum so viele Österreicher beim Anblick eines Flüchtlings offenbar denken, „der nimmt mir gleich etwas weg/der tut mir gleich etwas an“ und nicht: „Zum Glück ist mir das nicht passiert“, so wie sie es bei jedem Unfallopfer oder Krebspatienten selbstverständlich tun. Die geniale, bis heute berühmte Wiener Plakataktion aus den Siebzigern, „I haaß Kolaric, du haaßt Kolaric, warum sogn’s zu dir Tschusch?“, die in den Neunzigern mit „Was täten wir ohne Zilk, Busek etc“ weitergeführt wurde, war ein Schritt in diese Richtung, aber bei weitem nie genug. Ich habe, himmelschreiend naiv, immer darauf gewartet, dass etwa die SPÖ oder eine große Bank oder irgendeine mäzenatische Organisation mit Geld und Rückgrat Fernsehspots schaltet, in denen Ausländer in fünfzehn Sekunden sagen, wer sie sind und warum sie hier sind. „Mein Name ist Ngozi, zu Hause in Nigeria wurde meine ganze Familie umgebracht, jetzt bin ich hier, arbeite bei der Grazer Müllabfuhr und habe schon viele Freunde. Und übrigens: Nur, weil ich schwarz bin, habe ich es noch lange nicht auf Ihre Handtasche abgesehen, gnädige Frau“. Kreative und witzige Aktionen im Geiste des Kolaric hätten gewiss mehr verändert als die jahrelange, kollektive Angstlähmung in den Parteizentralen von SPÖ und ÖVP vor den krakeelenden Rechten, auch mehr als all die spitzfindigen Intellektuellendebatten zur Frage, ob man den feschen Haider in den „guten“ Zeitungen auf Fotos zeigen darf oder lieber nicht. Aber so eine kritisch-politische Gegenöffentlichkeit in Form von intelligentem Spaß und faktensicherem Protest hat es in Österreich nie gegeben, sieht man von den Donnerstagsdemos und dem eingeschworenen Kreis der „Falter“-Leser einmal ab. Man hat den Boulevard der „Kronenzeitung“ überlassen und sich darauf verlassen, dass sich die sogenannten Vernünftigen ihr Teil denken, im guten, alten Grillparzer-Stil. Das war höchst fahrlässig. Denn es hat sich etwas verändert, es hat seit den frühen Neunziger Jahren eine spürbare moralische Erosion stattgefunden. Heute werden in Österreich von Durchschnittsbürgern Dinge geäußert, die einem die Haare zu Berge stehen lassen, besonders wenn man, wie ich, in Deutschland lebt, wo es in manchen Großstädten durchaus Ausländerprobleme gibt, von denen unsere „Insel der Seligen“ sehr weit entfernt ist.
Ob die spanischen Heidelbeeren eventuell von „Negern“ gepflückt worden seien und sie sie lieber wegwerfen solle, beschäftigte eine Bekannte meiner Mutter; dass der türkische Supermarkt im ehemaligen Geschäftslokal eines traditionellen Herrenausstatters (der ganz ohne türkisches Zutun bankrott gegangen war) einfach eine Schande sei, klagte eine andere. Im Wartezimmer eines niederösterreichischen Notars wurde ich von einer gutsituierten Dame mit schrillen Beschwerden überfallen: Man könne in Wien als alleinstehende Frau nicht mehr ins Theater gehen, behauptete sie, an allen Ecken Türkenbeiseln, wo immer sie ihr Auto parken wolle, stünden fremdländische Männer am Gehsteig. Und sie wolle doch, zumal ins Theater, durchaus ihre Perlen tragen! In Berlin sei das sicher genauso schlimm, schloß sie mitfühlend, nickte und wurde leider aufgerufen. Denn sonst hätte ich ihr erklären müssen, dass es in Berlin einen grundlegenden Unterschied gibt: Dort ist man an den Anblick von Andersartigkeit schon so lange und intensiv gewöhnt, dass man nicht von jedem Dunkelhäutigen oder Schwarzhaarigen automatisch annimmt, er wolle einem mindestens an die Perlen. Während sich in Österreich die statistische Sicherheit und die politische Hysterie umgekehrt proportional zueinander verhalten.
Wenn Aufklärung und Vernunft die Menschheit erleuchten, dann schien mir Kärnten in den letzten Jahren ein besonders dunkler Winkel meines ganzen problematischen Heimatlandes zu sein. Das Stimmverhalten der Kärntner mit den überwältigenden Mehrheiten für den grinsend Schecks verteilenden, dabei das Kärntner Familiensilber verschleudernden Haider und seinen negerwitzeerzählenden Nachfolger, die jahrzehntelange pathologische Ablehnung von ein paar zweisprachigen Ortstafeln, die Lockerung der Radmuttern am Wagen jenes Mannes, der die Kabarettisten Stermann & Grissemann nach Kärnten eingeladen hatte – das alles sprach von finsterer, geisttötender Provinz. Seit manch liberale israelische Freunde vom immer orthodoxer werdenden Jerusalem als „Ayatollah-Town“ witzeln, dachte ich, die ich als junges Mädchen, begleitet nur von Handke-Romanen , schwelgerisch über den Wörthersee gerudert war, an Kärnten nur noch als rettungsloses „Ayatollah-County“.
„Wo ist eigentlich das andere Kärnten?“ schrieb ich am Ende eines bitteren Artikels in der „ZEIT“, der mir nicht nur eine Klagsandrohung von Claudia Haider, körbeweise empörte Leserbriefe im Stil von „in Kärnten isst man nicht Knödel, sondern Nudeln, Sie Ignorantin!“ und anheimelnde Zeitungskommentare wie „Frau Menasse ist wohl gut beraten, in naher Zukunft keinen Urlaub in Kärnten zu planen“ einbrachte, sondern, einige Zeit später, auch die E-Mail eines gewissen Herrn Brandstätter, der mir sein Foto-Projekt „Colours of Carinthia“ ankündigte. Er habe sich von meinem Schlußsatz gemeint gefühlt, schrieb er mir zur Erklärung – und ich sah ein erstes kleines Licht aufgehen.
Nun ist es geschafft. Hier liegt das Buch zu jener Fotoausstellung vor, die beweist, dass Kärnten eben nicht nur von mistgabelschwingenden Ortstafel-Stürmern und weltkriegSSeligen Ulrichsberglern bewohnt ist. Das ist ein Klischee, ein starkes und wirkmächtiges allerdings, dem jeder vernünftige Kärntner von nun an endlich so lautstark entgegentreten sollte, wie es bisher immer nur die Deutschtümler und Slowenenfresser waren. Dieses Buch zeigt, dass es kleine gallische Dörfer gibt, Menschen, die es schaffen, friedlich und freundschaftlich miteinander zu leben, obwohl die einen nicht aussehen wie der sprichwörtliche eingefleischte Kärntner. Und weil die anderen nicht so denken.
Insofern haben Christian Brandstätter, Karlheinz Fessl und all die anderen, die an der Entstehung dieses Buches mitgewirkt haben, damit begonnen, den Ruf Kärntens zu reparieren. Mögen es ihnen in Zukunft viele gleichtun.“