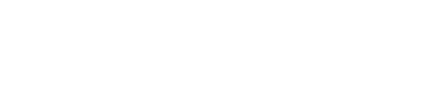Während Kenia im Sumpf der Korruption versinkt, führt ein kleines Waisenhaus, im äußersten Westen des Landes, einen täglichen Überlebenskampf. Es liegt an Afrikas größtem und der Welt drittgrößtem See, dem Lake Victoria.
Karlheinz Fessl (Text und Fotos)
Mary, Jane und Cecilia haben sich einfache Decken in den Schatten gelegt. Sie ruhen wie gestrandete Wale auf dem Terrassenboden. Eines ihrer Kinder, Barack, gerade ein Jahr geworden, kuschelt sich an Mary. Ruth, schon sieben, spielt schlaftrunken im Hintergrund. Ein scheinbar kontemplatives Bild aus dem hintersten Kenia.
Zwei Drittel der Kinder, die im Waisenhaus von Nyangoma leben, hatten die letzten Wochen die Masern. So waren die Nächte kurz. Ein paar der Mütter holen sich nach dem Mittagessen, was Ihnen akut fehlt: Schlaf!
Zu Mittag gab es Ugali. Maiskörner, Salz, ein wenig Wasser. Das reicht. Die Kinder von Nyangoma kennen kaum ein anderes Mittagsmahl. Ugali ist für viele Menschen Ostafrikas ein Synonym für das Wort Speise geworden. Auch für die Kinder von Nyangoma. 59 Waisen leben hier. Der Victoriasee, der so groß wie die Schweiz ist, liegt fast in Rufweite. Und dennoch ist es ein Festtag, wenn der Victoriabarsch in die Pfanne kommt. Nahezu alles, was der See an Ertrag bringt, geht als feinste Filets in den Export. Den Afrikanern bleiben Reste, Abfälle. In den vierzig Jahren, seitdem der Nilbarsch hier ausgesetzt und heimisch wurde, vernichtete er nahezu 200 andere Fischarten. Feinde hat er hier keine.
„Wir leben von der Hand in den Mund”, sagt Schwester Josephine, die das Waisenhaus von Nyangoma leitet. Sie schreibt einen Bettelbrief nach dem anderen. Und ist erfolgreich. Mit drei weiteren Franziskanerinnen und rund fünfzehn weltlichen Mitarbeiterinnen kommt Josephine über die Runden. – „Und mit zwei Kühen!”, dachte sie sich, vor ein paar Jahren. Die Schwestern sind, wie so viele Menschen, hier im äußersten Westen Kenias, Subsidiaritätsbauern. In Eigenverantwortung hielten sie zwei Rinder, die die Milch für ihre Kinder bringen sollten. Der Ertrag waren fünf Liter. Mehr gab der karge Boden an Futter nicht her. 4.200 Euro reichen den Franziskaner- Schwestern von St. Anna, ihr Waisenhaus über einen ganzen Monat zu retten. Darin sind alle Gehälter, alle Lebensmittel, alle Anschaffungen, die Erhaltung des Hauses, selbst die Briefmarken für die Bettelbriefe, enthalten. Dem Staat Kenia war Nyangoma bislang kaum mehr als ein Dekret wert. In ihm wird bestätigt, dass das Waisenhaus, das holländischen Schwestern gegründet haben, das Recht hat, betrieben zu werden. Das ist so großzügig wie zynisch. Seit 1966 wurden weit über 400 Kinder versorgt. In der gesamten Provinz Nyanza ist Nyangoma der einzige Ort, an dem man sich auch unversorgter Neugeborener annimmt. Ein paar läppische Beträge kamen dennoch vom Staat. So unerwartet wie sporadisch. Wie Kenias Prioritäten aussehen, erzählt eine Geschichte, die in der Provinzhauptstadt Kisumu in aller Munde ist: Als es, nach den letzten landesweiten, schwer manipulierten, Wahlen, Ende 2007, zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen zwischen den Ethnien kam, gelang es erst Friedensnobelpreisträger Kofi Annan diplomatisch zu vermitteln und einen Kompromiss zu finden: Ein Kikuyiu, somit ein Vertreter der größten Ethnie wurde Präsident. Und Raila Odinga, ein Angehöriger der Luo, der drittgrößten ethnischen Gruppe des Landes, die im Westen lebt, wurde Premierminister. Odinga pendelt seither ständig zwischen seiner Heimat und der Hauptstadt Nairobi. Gleich, nachdem die leichengepflasterten Straßen Kisumus gereinigt waren, begann man, Odinga eine eigene, exklusive, Flughafen-Landebahn zu bauen. Das Geld dafür war da. Da hat man nicht lange nachgedacht in einem Land in dem 56 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Seit Annans Vermittlung herrscht Ruhe. Scheinbar. Es brodelt nur noch im Hintergrund.
Die Tage sind ausgefüllt in Nyangoma: Schwester Margareth sitzt an der Strickmaschine und arbeitet an Wollpullovern für die Regenzeit. Jane wäscht draußen, im angebauten Gebäude, Windeln in bunten Plastikeimern. Samuel kocht in den Holzöfen Porridge, die Mahlzeit, die an die britische Kolonialzeit Kenias erinnert. Das Land ist seit 1963 unabhängig. Porridge kommt immer noch in die Plastikbecher der Kinder. Shella flickt gerade in der Schneiderei einen Sitzüberzug zusammen. Schwester Josephine kümmert sich darum, dass die Vorräte nicht völlig versiegen, führt ein Telefonat ums andere und hat im nächsten Moment eines ihrer kränklichen Sorgenkinder im Arm, um ihm Medizin zu verabreichen. Mary und Emily, die Mütter von Familie Drei, waschen die Böden ihrer Wohnstatt heraus. Dominic schleppt einen Sack Mehl ins Depot. Und überall dazwischen wuseln lachende, ernste, interessierte, verspielte, aufgeweckte Kinder durch Gänge, ins Freie, in den Garten, ums Haus. Kinder, die Jane oder Joyce, Milbret oder Joseph, Monica oder Ryan, Barack oder Consulata, Fidel oder Emanuel heißen.
Nur an einem Ort ist es ruhiger als überall herum. In der Sick-Bay, im improvisierten Krankenzimmer, wo sich Leben und Tod näher kommen, als anderswo in Nyangoma: Tabetha switcht ihre Aufmerksamkeit seit Stunden ununterbrochen zwischen dem vier Monate alten Hamstone und den beiden drei Wochen alten Zwillingen Cosmas und Herine. Tabetha strahlt unendliche Ruhe aus. Man sieht ihr aber auch die Anstrengung der letzten Tage an. Die Sorge um das Leben der beiden zwei Wochen zu früh zur Welt gekommenen Zwillinge, deren Mutter, von der Malaria geschwächt, die Geburt nicht überlebte. Nach gut eineinhalb Stunden aufopfernden Fütterns der Babys, erhebt Tabetha, die nur über die einfachsten medizinischen Mittel verfügt, ihre Stimme zu einem einzigen Satz: „So sick!”, flüstert sie. Danach arbeitet sie weiter, wie die Stunden zuvor. Die Zwillinge atmen flach. Am frühen, nächsten Morgen bleibt einer der Franziskanerschwestern nichts anderes übrig, als den schweren Weg ins Gästehaus von Nyangoma zu machen, um dem Vater der Mädchen, die Nachricht zu überbringen, dass eines der beiden die Nacht nicht überlebt hat.
Dass in der selben Nacht in der Medikamentenabgabestelle hinter dem Waisenhaus, die wie die daran angedockte HIV-Station auch von den Schwestern von St. Anna-Lwak betrieben wird, ein Baby zur Welt kommt, steht wie ein Symbol für den Fortgang der Dinge in dieser Region, wie für den ewigen Kreislauf schlechthin: Kenia allein lag 2003 -und von später lassen sich kaum noch offizielle Erhebungen recherchieren- mit 150.000 Toten, an der weltweit vierten Stelle der Aids-Statistik. Dies in einem Land, in dem auf 6.000 Einwohner ein einziger Arzt kommt. Das kenianische Gesundheitsministerium, das seit 1987 NASCOP betreibt, das nationale Programm zum Stopp von Aids, hat Erfolge zu vermelden, die sich in Grenzen halten: 2004 waren 7,4 Prozent aller 15-49jährigen Kenianer HIV positiv. In der Provinz Nyanza am Victoriasee, zu der auch Nyangoma gehört, liegt die HIV-Rate jedoch bei 15,3 Prozent , also doppelt so hoch, bestätigt das Gesundheitsministerium. Und das US-Census-Büro weist für das selbe Jahr aus, dass etwa 8 Prozent aller schwangeren Frauen HIV positiv sind. 1998 waren es sogar noch 28 Prozent. Für sehr lange Zeit lag die Heimatprovinz der Schwestern von St. Anna an der Landesspitze. Die Weltgesundheitsorganisation veröffentlichte Zahlen aus 2003 wonach Aids der Grund für 15 Prozent aller Todesfälle von unter 5jährigen Kenianern wäre, während 14 Prozent dieser jungen Menschen von Malaria hinweggerafft würden. Aids hat in Kenia längst epidemische Ausmaße angenommen.
So wird klar warum schon weit bevor 1975 das Waisenhaus gebaut wurde, die Schwestern in ihrem Konvent Kinder aus der gesamten Provinz aufnahmen. Aids ist nur einer der Gründe, warum hier so ausnehmend viele Kinder, oft von Geburt an, ohne Eltern da stehen. Andere heißen Malaria oder Zwillingsgeburten, die sehr oft den Tod der Mutter bedeuten. Die fatale Situation, dass sich eine Familie einfach kein weiteres Kind mehr leisten kann. Oder, dass das Baby Folge einer Vergewaltigung war. Oder der Umstand, dass junge Frauen geächtet werden, weil sie von einem Mann, der in einer Vielehe lebt, nach dem Geschlechtsverkehr wieder verlassen wurden. Viele junge Mütter stehen daher nicht zu ihren Kindern. Immer wieder werden Säuglinge in den Feldern rund um Nyangoma gefunden.
„Die Menschen sollten ihre Haltung ändern!”, mahnt Schwester Arnolda, die die HIV-Station in Nyangoma leitet, „ein Mann darf vier Frauen haben. Ein Mann sollte nur eine Frau haben!”
Die Polygamie ist weit verbreitet und der Papst verbietet Kondome.
„Es gibt – gottlob! – zahlreiche Kirchenleute, die nicht viel reden, sondern handeln und die, in Anbetracht der Pandemie, die geradezu kriminellen Gebote des Vatikans ignorieren”, schreibt der deutsche Journalist und Afrika- Experte Bartholomäus Grill während er aus Sambia, einem anderen von AIDS gepeinigten Land berichtet. Grill zitiert einen irischen Priester: „Es ist unsere Christenpflicht, Leben zu schützen”, sagt er, dessen Auto voll beladen mit Kondomen ist, die er nach dem Gottesdienst verteilt.
Ähnliches, wenn auch nicht so rigoros, kann man in Nyangoma beobachten. Keine der Schwestern würde Kondome selbst verteilen, aber was die weltlichen Mitarbeiter der Aids-Station machen, darüber redet niemand.
Ein neuer Tag, neue Hoffnung: Das Waisenhaus ist organisiert wie die SOS- Kinderdörfer, deren erste in Österreich gebaut wurden und die heute weltweit Waisen ein zu Hause geben. An die zehn Kinder leben mit zwei Müttern in einer Familie. Vier solche Familien beherbergt Nyangoma. Daneben liegen die Station für ältere kranke Kinder und die Sickbay für zumeist schwerkranke Babys. Alle Familien und alle Mitarbeiter, weltliche, wie geistliche, beginnen den Tag im karg eingerichteten Gemeinschaftsraum. Wie hier im Gebet und Gesang, täglich aufs Neue, Gott angerufen wird, was hier an Optimismus, Gemeinsinn und Empathie, gelebt wird und oft mit Stimmen, die jedem Gospelchor zur Ehre gereichen würden, fast als Überschrift über den neuen Tag postuliert wird, sucht seinesgleichen und vermag die Kraft zu erklären, aus der diese Menschen leben:
Pelecia ist eine derjenigen Frauen, die das gesamte Jahr über mit 21 Urlaubstagen auskommen müssen. Auch Wochenenden gibt es nicht. „Denn”, sagt Schwester Josephine, „würden unsere Mütter nicht wirklich wie in einer Familie mit den Kindern leben, würde es hier nicht funktionieren. Die Mütter leisten großartige Arbeit und es ist kein Wunder, dass die Kinder tatsächlich Ihre Betreuerinnen Mum rufen.” Pelecia ist selbst als Waise in Nyangoma groß geworden. Schon nach der achten Klasse der Primary School, die als eine von zahlreichen Einrichtungen innerhalb der Missionsstation betrieben wird, begann Pelecia sporadisch im Waisenhaus zu helfen. Seit vier Jahren arbeitet sie als Mutter. Die schüchterne, junge Frau, hat ein Händchen für Ihre Kinder und man braucht nur einmal zu Gast in Familie Zwei zu sein, um zu erkennen, wie viel Liebe sie ihren Kindern entgegen bringt. Ihre Zwillingsschwester lebt heute zu Hause bei Ihrer Rest- Familie. Sie ist ein Beispiel dafür, wie gut es, in der Mehrzahl der Fälle, den Schwestern von Nyangoma gelingt, Kinder, schon nach ihrem vierten Lebensjahr bei entfernteren Verwandten zu reintegrieren. Nur selten gibt es gar keine Angehörigen mehr, wie etwa bei Ruth, dem mit sieben Jahren derzeit ältesten Waisenkind. Sie darf freilich bleiben. Für Kinder wie Ruth wollen die Schwestern von St. Anna-Lwak jetzt ein Übergangsheim bauen, in dem Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr eine Heimstatt finden sollen. Mit welchen Mitteln wissen sie noch nicht, aber dass sie es tun werden, steht fest.
Moses ist jemand, für den dieses Heim schon ideal gewesen wäre. Er ist leicht behindert und hat sich schwer getan, außerhalb des Waisenhauses Anschluss zu finden. So ist Moses einfach geblieben. Heute ist er 23 und ein tüchtiger Helfer in Nyangoma. Er packt alles an und ist der Mann fürs Grobe.
Oder William, von dem sich Schwester Josephine wohl wünscht, dass er Priester würde. Eines Sonntags kommt er herein spaziert. Man hat das Gefühl William, heute 28, wäre nach Hause gekommen. Er besucht seine ehemalige Familie. Seine leibliche Mutter starb bei seiner Geburt. Seinen Vater verlor er zwei Jahre später. Nachdem er vier Jahre alt war, durfte er bei seiner Großmutter leben. In Usenge besuchte er die Primary School. Die Schwestern Margareth und Josephine kamen persönlich für sein Schulgeld auf und so konnte William auch die Secondary School besuchen. Es gelang ihm sogar in der Provinzhauptstadt Kisumu das Diplom in Angewandter Biologie abzulegen. Jetzt ist er auf Jobsuche. Und optimistisch, dass er eine Stelle in seinem Traumberuf, als Laborant, findet. „Zurück kommen, ist wie heim kommen!”, strahlt er von innen.
Da sind aber auch noch zwei steinalte Frauen, die Nyangoma ausmachen: Leah und Teresa. Es vergeht kein Tag an dem nicht, zumindest eine der beiden, zur Tür des Waisenhauses hereinschlurft. Mildtätigkeit und Warmherzigkeit sprechen aus den Gesichtern zweier alter Frauen. Sie kommen zu keinem anderen Zweck als dem, den Kindern Großmutter-Ersatz zu sein. Sie kommen, um Geschichten zu erzählen. Sie tun das auf eine Weise, wie wir sie, hier in Europa, kaum noch kennen. Sie erzählen von alten Zeiten, wiegen Kinder in den Schlaf, haben ein Märchen auf den Lippen. Leah und Teresa tun das tagein, tagaus. Unbezahlt.
Der Kosmos der meisten Menschen Nyangomas ist sehr klein. Wem zur Fortbewegung ein Bus zur Verfügung steht, nur einmal am Tag, zeitig am Morgen, wer gar nur ein Fahrrad hat oder ausschließlich zu Fuß unterwegs ist, kommt nicht weit. Bondo, die nächste Stadt, liegt 15 km entfernt. In Bondo bekommt man Trinkwasser. Hier werden Särge in den Straßen zusammengetischlert, Autos repariert, Fahrradschläuche geklebt. Hier gibt?s Schneiderwerkstätten und eine Bank. Ein wenig Obst wird feilgeboten. – Nyangoma hingegen, das ist zunächst eine staubige, zerfurchte, lehmige, rote Straße, die sich, bevor sie den Ort erreicht über sanfte Hügel stetig abwärts schlängelt. Fünf Kilometer nach dem Ort wird sie immer schmäler, um im Busch, vor den Ufern des Victoria Sees, zu enden. Es gibt kein wirkliches Zentrum in Nyangoma. Auf der einen Straßenseite stehen ein paar einfache Hütten, ein ineinander verschachteltes Betonkonstrukt, das zwei, drei Geschäfte beherbergt, eine weitere Hütte aus Holz und Wellblech die ein handgemaltes Schild als „Sweetland Hotel” ausweist. Auf der anderen Straßenseite werden zwei typisch karge afrikanische Fußballfelder von einem Volleyballplatz getrennt. Selbst in der Gluthitze eines Sommertags, kicken die Buben und jungen Männer hier: Ihr Schuhwerk, wenn sie überhaupt welches tragen, ist so unterschiedlich wie das Material, aus dem die Bälle improvisiert sind: Die Spieler tragen Badesandalen, Segelturnschuhe, ausrangierte Flipflops und ganz selten auch Fußballschuhe mit richtigen Stoppeln. Ist kein alter Fußball zur Hand, genügt auch ein Fetzenlaberl, das sie sich aus Palmblättern, Plastiksackerln oder Stoff notdürftig zusammennähen. Hinter diesen Sportplätzen liegt das hektargroße Gelände, das Nyangoma wohl erst zum Ort gemacht haben dürfte: Die christliche Missionsstation, in deren Zentrum eine mit einfachsten Mitteln errichtete katholische Kirche steht. Rundherum liegen, nicht wirklich gruppiert, sondern wie wahllos hingestreut, unterschiedlich große Festbauten: Eine technische Schule, eine Schule für Gehörlose, ein Männer- und ein Frauenkonvent, eine Vorschule, eine Grund- und eine fortführende Schule, ein Mädcheninternat, eine Krankenstation für die umliegende Bevölkerung, Büro und Wohnstatt von Father Peter, der geistlichen Stütze der Station und schließlich das Waisenhaus.
Sonntags, nach der Kirche, ist Markt in Nyangoma. Da wird dann doch so etwas wie ein Ortszentrum erkennbar. Die Händler haben tiefreife Bananen, Tomaten und Erdäpfel wohlfeil auf dem Boden ausgebreitet. Ein wenig Geschirr, Zuckerrohr, ein Sisalseil. Das ist schon der ganze Markt. Das ist schon ganz Nyangoma. Das ist die ganze Welt. Etliche von den Wenigen, die hier leben, waren noch nie in Bondo. So mancher hat sich noch nie in ein Matatu, eines der Sammeltaxis, gequetscht, um die eine Fahrstunde nach Kisumu, der drittgrößten Stadt Kenias, deren Bevölkerung sich binnen 40 Jahren verzehnfacht hat, zurückzulegen.
Die Franziskanerschwestern von St. Anna-Lwak und deren Waisen hatten von 1967 an, das Glück, dass es in der ersten Welt schon lange Persönlichkeiten und Organisationen gibt, die ihren Fokus auf die dritte Welt richteten. Selbst bis hinein in die ganz kleine Welt von Nyangoma. Terre de Hommes ist ein Kinderhilfswerk, das der Schweizer Journalist Edmond Kaiser 1959 unter dem Eindruck des Algerienkrieges gründete. Antoine de Saint-Exuperys gleichnamiges Buch inspirierte Kaiser zum Namen seiner Organisation, die bis zum heutigen Tag 500 Hilfsprojekte in 25 Ländern unterstützt. Kindern aus dem Vietnam- und Biafrakrieg wurde auf diese Weise geholfen. Und die Kinder aus Nyangoma erhielten vierzig Jahre lang regelmäßige Unterstützung von Terre des Hommes. Das heutige Waisenhaus wurde 1975 vollständig von dieser weltweit agierenden Einrichtung finanziert. Seit 2007 dieser Geldkanal versiegte, weil sich Terre de Hommes auch anderen sozialen Brennpunkten zuwandte, tun sich die Schwestern von Nyangoma sehr schwer das Geld für das Fortkommen des Waisenhauses zusammenzukratzen. Zwar hat sich im deutschen Köln 1995 der Verein Freundeskreis Nyangoma gegründet. Seine Mitglieder akquirieren fleißig Spender und Sponsoren. Und sie kommen auch, um in selbstlosen Arbeitseinsätzen Hand anzulegen. „Leider ist das”, wird Schwester Josephines Stimme fast ein wenig resignativ, „immer noch zu wenig!” „Hakuna matata!” – „Kein Problem!” Irgend wie geht es immer weiter. Und schon wählt sie die nächste Nummer und bettelt nicht nur in Briefen, sondern auch am Telefon. Umgerechnet 50.000 Euro Jahresbudget klingen für einen Betrieb, der mehr als fünfzig Kinder versorgt und fast dreißig Mitarbeiter beschäftigt, bescheiden. Im Land Geld zu lukrieren, ist kaum möglich. So blieben der Budgetposten Betten, Matratzen und Decken im vergangenen Jahr überhaupt auf Null gesetzt. Und wenn man weiß, dass dem Waisenhaus im gesamten letzten Jahr 60.000 Kenia Shillings, das sind 575 Euro, für den Einkauf von Medikamenten zur Verfügung standen, erkennt man die enorme Leistung der Schwestern und Mütter von Nyangoma, die nur 45 Sterbefälle unter den bisher 434 aufgenommenen Waisen, während all der Jahre seit 1970, beklagen mussten.
„45 tote Kinder zu viel!” bleibt Schwester Josephine lapidar und weiß, dass noch so viel zu tun ist. Sie führt ihren Kampf unter erschwerten Bedingungen: Die meisten der Kinder, die in Nyangoma aufgenommen werden, sind HIV- positiv. Schwester Josephine träumt vom Zugang zu mehr Medikamenten. Durch Ernährung, die so ausgewogen wie unter den Umständen möglich ist, durch eine tadellose Hygiene-Situation, eine immerhin notdürftige medizinische Versorgung und optimale menschliche Zuwendung, gelingt es ihr dennoch, dass es kaum zum Ausbruch von Aids kommt. Das Trinkwasser bezieht die Missionsstation seit 2006 aus einer Wasseraufbereitungsanlage am Victoria See. Die Regierung unterstützt das Projekt immerhin. Verunreinigtes Trinkwasser ist der häufigste Grund für den Ausbruch von Krankheiten, nicht nur in Kenia. Die Kinder werden routinemäßig jedes halbe Jahr untersucht. Während Schwester Arnoldas Kummer darüber größer wird, dass die Aids-Rate in der Region um Nyangoma von Monat zu Monat wächst, leben im Waisenhaus derzeit nur vier Kinder mit dem HI-Virus. Ein typisch afrikanischer Teilerfolg. „Denn”, erzählt Arnolda, „in Kisumu werden nach wie vor Bluttransfusionen ohne HIV-Tests durchgeführt!”
Simon, David und Peter bewachen das Waisenhaus. Tagsüber, wenn sie im Schatten eines palmengedeckten Daches vor dem Haupteingang lungern, scheinen sie völlig überflüssig. Nachts schon nicht mehr. Jedenfalls wirken die die drei Watchmen, als wollten sie Nyangoma vor dem ganz normalen Wahnsinn Kenias schützen: Als Präsident Kibaki, Ende 2002 an die Macht kam, erklärte er umgehend die Bekämpfung der Korruption zu seiner Hauptaufgabe. Sechs Jahre später titelte Thilo Thielke im deutschen Magazin Spiegel: „Kenias Mammutkabinett treibt das Land in den Ruin” und wusste zu berichten, dass die 94 Minister und Hilfsminister die sich das Land leistet, im Jahr 5,5 Milliarden Dollar verschlingen, während fast jeder zweite Einwohner hungert. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Als mein Taxifahrer auf dem Weg zum Flughafen in Nairobi einer Ministerwagenkolonne begegnet, spuckt er aus dem Fenster. In Nyangoma schiebt man das alles zur Seite. Da kümmern sich ein paar kleine Nonnen um ein paar kleine Menschen. Ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine kleine Dinge tun, werden das Antlitz dieser Welt verändern.”
Karlheinz Fessl arbeitet seit Jahrzehnten als Fotoreporter und als Fotograf für Werbeagenturen und Verlage. Stets von seiner Homebase aus, die im provinziellen Kärnten liegt, reist er an die Schauplätze seiner Reportagen: Nach Kuba, auf die Orkneys, häufig nach Osteuropa und Anatolien. „Das Fest, das mir am Ende meiner Tage in Nyangoma bereitet wurde, gehört zu den berührendsten Momenten meiner Laufbahn.”